Der nächste Shift im Nachhaltigkeitsdenken
Februar 2025
Die Anzeichen häufen sich, die darauf hindeuten, dass die „Große Transformation“ unserer Wirtschaft und Gesellschaft hin zu einer postfossilen Lebensweise ins Stocken gerät und die „Agenda 2030“ als umfassendes Programm für einen weltweit gerecht verteilten Wohlstand fünf Jahre vor der Zielgeraden als aussichtslos erscheint. Das Magazin „Der Spiegel“ stellte zum Jahresende fest: „Ende 2024 fanden vier Uno-Treffen zu Weltproblemen wie Artensterben, Klimawandel, Plastikmüll und Wüstenbildung statt. Alle sind krachend gescheitert oder endeten mit einem Minimalkonsens.“ Und der jüngste Wahlkampf in Deutschland wurde nicht darum geführt, wer beim Thema "Nachhaltigkeit" die Nase vorn hat, sondern ob und wie Migration und die Kosten der Energiewende unsere Sicherheit und Wirtschaftskraft bedrohen.
Auch die soeben erschienene Studie „Neue Horizonte 2045“ hält zwei eher veränderungsaverse „Bewahrungs- und Stabilisierungsszenarien“ für die dominanten der nächsten 20 Jahre. Stehen wir also vor dem Ende des „ökoemanzipatorischen“ Projekts? Exakt 100 Leserinnen unseres Newsletters haben unsere Umfrage zu diesem Thema beantwortet. Lesen Sie hier, warum dieses Meinungsbild einen fundamentalen Shift im Nachhaltigkeitsdenken nahelegt, der ein Spiegel grundlegender politischer Veränderungen sein könnte…
Die erste Frage, die wir stellten, wollte wissen, welcher Faktor am meisten zum Erfolg von „Nachhaltigkeit“ in unserer Gesellschaft beiträgt:
- Freiheit der individuellen Lebensgestaltung 4 %
- Bildung und Chancengleichheit 49 %
- Strengere Regeln und Gesetze 44 %
- Notfalls autokratischere Formen des Regierungshandelns 3 %
Das Bild zeigt, dass das „liberale“ und das „autoritäre“ Konzept nahezu gleich viele Anhänger haben. Während 53 % die Aspekte der individuellen Handlungsfreiheit, des Handelns aufgrund von Wissen und Teilhabemöglichkeiten betonen, setzen 47 % auf staatliche Regulierung bis hin zu autokratischen Entscheidungsformen.
Auch der Club of Rome setzt in seinem jüngsten Bericht auf den starken Staat, der eine steuerpolitische „Kehrtwende“ fordert, die darin besteht, „dass den reichsten zehn Prozent künftig nicht mehr als 40 Prozent des jeweiligen Nationaleinkommens zusteht“. Diesem Vorschlag folgen in unserer Befragung 72 %, die ihn für notwendig halten. Allerdings nur 9 % kreuzen an, dass der Vorschlag realistisch sei. Dennoch bleibt festzuhalten, dass 81 % einen massiven vermögenspolitischen Eingriff des Staates für geboten halten, um auf dem Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft voranzukommen.

Soziologen wie Ingolfur Blühdorn sehen einen Zusammenhang zwischen dem „ökoemanzipatorischen“ Politikkonzept und dem Erstarken rechter Kräfte in westlichen Gesellschaften. Wir wollten wissen, wie unsere Leser das sehen. Gibt es diesen Zusammenhang:
- überhaupt nicht 4 %
- möglicherweise 25 %
- in mancher Hinsicht 46 %
- auf jeden Fall 25 %.
Die Klarheit dieser Aussage hat uns überrascht. 71 % erkennen diesen Zusammenhang und weitere 25 % halten ihn zumindest für möglich. Das heißt, 96 % der Befragten bestätigen die Diagnose, wonach die ökoemanzipatorische Politik der letzten Jahrzehnte paradoxerweise den rechtspopulistischen Tendenzen Nahrung geboten hat.
Was sich nun in der Zusammenschau der gesamten Befragung ergibt, möchte ich als These in den Raum stellen: Hat nicht nur das ökoemanzipatorische Projekt die autoritären Gegenkräfte bestärkt, sondern beeinflusst dies auch das Denken derer, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, in Richtung staatlicher Vorgaben und autoritärer Eingriffe? Verblassen Freiheit und Selbstbestimmung im Mindset der Nachhaltigkeitsbefürworter und entsteht ein übergreifender Konsens, der die Lösung gesellschaftlicher Probleme „von oben“ befürwortet? Zwingt sozusagen der Rechtsruck in unserer Gesellschaft auch den Protagonisten einer nachhaltigen Entwicklung ein autokratisches Lösungskonzept auf?
Weder hart noch fair – was Talkshows leisten müssten
Oktober 2024
Nach wie vor sind politische Talkshows ein wesentliches Element der demokratischen Auseinandersetzung in unserem Land. Fast 7 Millionen Menschen werden regelmäßig durch sie erreicht. Zu den häufig genannten Kritikpunkten gehört es, dass immer wieder dieselben Köpfe zu bestimmten Themenfeldern eingeladen werden und dass die, die da miteinander diskutieren, lebensweltlich weit weg sind von der Realität der meisten Bürgerinnen und Bürger, für die ja die Politik gemacht wird, um die man streitet. „Die Menschen, die in Talkshows sitzen, sind ganz häufig relativ weit weg von dem, wie Menschen zu Hause ihr Umfeld, ihre Probleme wahrnehmen und was sie grade beschäftigt“, stellte "Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth fest. Diesem „Entfremdungsprozess“ möchte der Moderator gern etwas entgegensetzen. Tatsächlich werden immer häufiger „Normalbürger“ in Talks wie "Hart aber fair" eingeladen. Klamroth versucht damit „auch Menschen mit ihren Themen reinzubringen in ein Talkshow-Studio, die nicht jede Woche irgendwo anders sitzen, sondern vielleicht noch nie im Fernsehen oder auf einer Bühne waren“. Ob das allerdings zu einer erhellenderen Debatte führt, mag man bezweifeln. Klamroth selbst beobachtet, dass Politiker sich durch die Anwesenheit von Normalbürgern beeinflussen lassen, in dem sie eher zurückhaltender werden. Der Moderator scheint das zwar als Vorteil zu werten, wenn er feststellt, dass es für die anwesenden Politiker „auf einmal ganz schwer (werde), die üblichen Phrasen über Bürgergeld loszulassen“, wenn ihnen ein Bürgergeld-Empfänger gegenübersitze, „weil das denen dann unangenehm ist“. Die „üblichen Phrasen“ sollten jedoch durch professionelle Moderation bereits als solche aufgelöst und durch profundere Aussagen ersetzt werden. Wieso sollte, was der Moderator nicht schafft, durch die bloße Anwesenheit einer unbedarften Bürgerin geschehen? Und ist es nicht gefährlich, zu unterstellen, Politiker würden nur Phrasen dreschen und Bürger/innen per se für Realismus, Echtheit und Wahrheit stehen? Das Verständnis des Jobs, das Louis Klamroth hier verrät, ist ob seiner Holzschnittartigkeit verstörend. Sollte eine politische Talkshow nicht eher dazu beitragen, die unterschiedlichen Realitätskonstruktionen, mit den Politiker verschiedener Couleur genauso unterwegs sind wie „Normalbürger“ aus verschiedenen Milieus, aufzuklären und ins Verhältnis zu setzen? „Normalbürger“ haben weder ein moralisches Plus gegenüber Politikern noch sind sie per se näher an der Wahrheit.
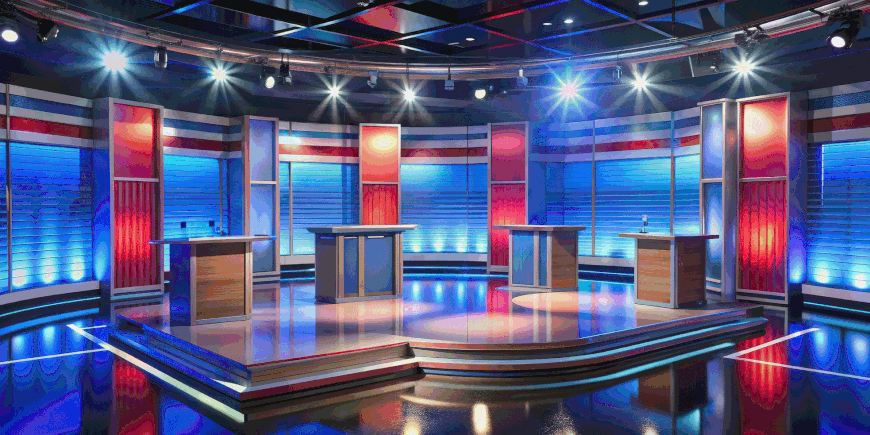
Warum sollte ein Politiker als „geübter Talkshow-Gast“ (Klamroth) einem eingeladenen „Normalbürger“ nicht auch kritische („harte“) Fragen stellen dürfen? Was nützt uns der Eiertanz von Politikern und Talkshow-Moderatoren um den zum unverdächtigen Zeugen hochstilisierten Bürger? „Fragen stellen“ führt uns sehr viel mehr ins Zentrum dessen, was eine Talkshow ausmachen sollte, als die Klamrothschen Klischees. Talkshow-Moderation, die einen aufklärerischen Beitrag leistet und die demokratische Debattenkultur verbessert, müsste die Kompetenz beweisen, Phrasendrescherei, das Sich-Gegenseitig-Ins-Wort-Fallen und das sture Beharren auf „Positionen“ zu durchbrechen. Das wäre so schwer nicht, wenn als Gesprächsregel eingeführt würde, keine Statements abzugeben, sondern fragend auf den Diskussionspartner einzugehen. Und als Gesprächsziel vereinbart würde, dass es nicht darum geht, eine Lösung für ein Problem zu finden oder festzustellen, wer mehr recht hat als der/die andere. Sondern zu verstehen, worin die Differenzen liegen und sich aktiv zuzuhören. Talkshow-Moderatoren müssten den sokratischen Dialog beherrschen und mit ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern so praktizieren, dass diese ebenfalls diesen Gesprächsstil erlernen. Dann würde es grundsätzlich „fair“ zugehen und wir würden an den Bildschirmen lernen, was Grundkompetenzen in einer demokratischen Gesellschaft sind. Leider sagt Louis Klamroth schon von vornherein, dass er da nicht mitmachen möchte: Talkshows, so meint er, seien „nicht der Ort, an dem die Debattenkultur in Deutschland gerettet“ werde. Doch, genau das wäre der Ort!
Lässt sich Verwaltung verändern, Herr Luhmann?
August 2024
Irgendwie kommt Deutschland nicht voran. Die Wirtschaft schrumpft, Infrastruktur bröckelt, Unternehmen klagen über immer mehr Bürokratie, während in den Bürgerämtern der Hauptstadt der Terminmangel längst chronisch ist. Wäre Nachhaltigkeit die Lösung? Entsprechende Verheißungen verbinden sich derzeit mit der Idee, das demokratische System durch Bürgerräte und eine „Große Kokreation“ (Jascha Rohr) zu reformieren, die Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft miteinander verbindet. „Aus der Ohnmacht des Einzelnen“ entstehe so die „Gestaltungsmacht der Vielen“. Mit diesem „Transformations“-Ethos will man jetzt sogar die öffentliche Verwaltung in die neue Zeit überführen. Der Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. publizierte jüngst einen Beitrag von Raban Daniel Fuhrmann über die Idee einer „transformationsfitten“ Verwaltung. Das Konzept wird derzeit in einem Projekt des Umweltbundeamts weiterverfolgt. Fuhrmann beschreibt das Projektziel so: „Es geht darum, die Form so zu gestalten, dass man über den Berg, jenseits der Krisenlagen, gelangt… Wie schaffen wir es gemeinsam über den Berg in das verheißene Land, wo Politik gelingt, Demokratie Freude macht und Verwaltung unauffällig für das Gelingen der Koproduktion guten Lebens sorgt?“ So viel messianische Energie kann einen stutzig machen. Wenn die ausdifferenzierten Systeme unserer Gesellschaft in ein großes Ganzes zusammengefügt werden und die öffentliche Verwaltung diese „umfassende Kultur- und Strukturveränderung“ sogar vorantreiben sollen, möchten wir uns doch erst noch einmal bei einem Experten vergewissern, der die Grundlagen für das Verständnis moderner gesellschaftlicher Systeme gelegt hat. Wir haben Niklas Luhmann eingeladen zu einem Dialog mit Raban Daniel Fuhrmann. Das vollständige Interview hier im stratum-Blog.
Richard Häusler (RH): Ich danke Ihnen beiden sehr, dass dieser Dialog über die Funktion der öffentlichen Verwaltung in unserer Gesellschaft zustande kommt.
Niklas Luhmann (NL): Schon der Begriff der Funktion weist uns darauf hin, dass wir es nicht mit Starrheit und Unbeweglichkeit zu tun haben. Die Funktion ist ein regulatives Schema für mehrere äquivalente Möglichkeiten. „x = blau“ kann z.B. ausgefüllt werden durch „Himmel“, „Meer, „Veilchen“ usw. Ein Tatbestand, der durch eine Funktion identifiziert wird, ist also wesentlich ersetzbar und in diesem Sinne fungibel.
Raban Daniel Fuhrmann (RDF): Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen tiefgreifenden Krisen und der notwendigen umfassenden gesellschaftlichen Transformation ist aber auch notwendig, starre, versäulte und hierarchische Strukturen der öffentlichen Verwaltung durch flexiblere, kokreativere und transparentere zu ersetzen.
NL: Vielleicht sollten wir erst einmal definieren, was Verwaltung ist. Verwaltungen können als Sozialsysteme aufgefasst werden, die darauf spezialisiert sind, Informationen ihrer Umwelt zu verarbeiten und in Form von bindenden Entscheidungen an die Umwelt zurückzugeben.
RDF: Aber dennoch müssen sie viel flexibler werden. Die Vielschichtigkeit der bevorstehenden Transformation – intern und extern, ökologisch und demokratisch, sozial und ökonomisch, digital und technisch – erfordert ein hohes Maß an Transformationskompetenz von öffentlichen Verwaltungen.
RH: Ist denn Verwaltung per se veränderungsavers?
RDF: Die Komplexität und das Potenzial von Transformationsprozessen liegen gerade darin, traditionelle Verwaltungslogiken durch neue, partizipative und kollaborative Ansätze zu ersetzen, die sowohl die Verwaltung selbst als auch ihre Beziehung zur Gesellschaft nachhaltig verändern.
NL: Das Werk der Verwaltung ist formal gesehen, die Entscheidung. Und der Entscheidung geht ein Verfahren voraus. Mit dieser Auslegung erhält das Handeln der Verwaltung den bekannten formalen und unpersönlichen ‚bürokratischen‘ Stil, dadurch wird es gegen funktionsfremde Komponenten, gegen persönliche Gefühle und kapriziöse Einfälle nach Möglichkeit immunisiert; dadurch wird es berechenbar und wiederholbar…
RH: Was ja sozusagen im Sinne des Erfinders lag…
NL: Durchaus. Natürlich stößt man damit auch an Grenzen. Rationale, wirtschaftliche, gerechte, gleichmäßige und gesetzliche Verwaltung fordert ein hohes Maß an regulativer Steuerung der Entscheidungsprozesse. Die Handhabung dieser Regeln wird für den Beamten zur Sache der Routine. Er engt seinen Horizont auf seine Routine ein und wendet sie infolgedessen auch in Fällen an, die ein Problem enthalten und eigentlich neu entschieden werden müssten.
RH: Hier müsste man also reformierend in den Verwaltungsprozess eingreifen…?
RDF: Es geht um weit mehr. Solange wir Krisen mit Anpassungen am System lösen können, reichen Reformen aus. Nur wenn die bestehenden Aufgaben uns bereits ans Limit bringen und dann noch Krise um Krise uns überfordern, ist eine Transformation des Systems unabdingbar.
NL: Wir müssen hier gar nicht die Krise oder sogar Multikrisen heranziehen. Das Anpassungsproblem der Verwaltung bestand schon immer und es ist sozusagen auch konstitutiv für die Verwaltung, denn sie garantiert das Funktionieren der staatlichen Ordnung. So kommt es leicht, dass Verwaltungssysteme an inadäquat gewordenen Programmen kleben, überholte Zwecke verfolgen oder auf Zeichen reagieren, die in der Umwelt ihren alten Sinn längst verloren haben. Programme müssten im Grunde im Hinblick auf ihre Funktion laufend überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie noch stimmen. Eine solche Programmüberwachung und Programmänderung stoßen jedoch auf gewissen Schwierigkeiten… Dadurch kommen konservative Züge in die Verwaltung.
RDF: Deshalb muss ja auch Verwaltung sich selbst transformieren. Nur, wenn Verwaltung sich als selbsttransformierendes System versteht, das sowohl die internen Prozesse als auch die Interaktion mit der Stadtgesellschaft neugestaltet, kann sie ihre zentrale Rolle bei der Gestaltung sozialer, ökologischer, ökonomisch-digitaler und demografisch-kultureller Transformation wahrnehmen.
RH: Die Verwaltung soll die zentrale Rolle für die politischen Veränderungen übernehmen?
RDF: Es geht darum, die Form so zu gestalten, dass man über den Berg, jenseits der Krisenlagen, gelangt. Wie schaffen wir es gemeinsam über den Berg in das verheißene Land, wo Politik gelingt, Demokratie Freude macht und Verwaltung unauffällig für das Gelingen der Koproduktion guten Lebens sorgt?
NL: Vermutlich ist es die beste Möglichkeit, das Problem, dass Verwaltungen dazu neigen, an inadäquat gewordenen Programmen kleben, zu institutionalisieren, das heißt: es als besondere Aufgabe zu formulieren, es so in die allgemeine Programmstruktur des Systems einzubauen und in die Verantwortlichkeit einer besonderen Stelle zu geben. In diese Richtung zielen Bemühungen, die seit einiger Zeit unter der Bezeichnung ‚Stabsorganisation‘ weite Beachtung gefunden haben. Abgesehen von dieser vieldiskutierten Lösung gibt es wenig gesicherte Einsichten und Erfahrungen über das planmäßige Einführen von Neuerungen in Programmverwaltungen.

Niklas Luhmann: Als bedeutendster deutschsprachiger Vertreter der soziologischen Systemtheorie und der Soziokybernetik zählt Luhmann mit seiner Systemtheorie zu den Klassikern der Soziologie im 20. Jahrhundert.
RDF: Doch die gibt es. Die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in den Transformationsprozess spielt eine zentrale Rolle. Durch Bürgerbeteiligungsprojekte und öffentliche Konsultationen…
RH: Aber Bürgerbeteiligung kann doch Funktionsdefizite von Verwaltungen nicht lösen?
NL: In der öffentlichen Verwaltung werden die Bedingungen der Annahme von Entscheidungen außerhalb der Verwaltung, nämlich durch die politischen Prozesse der Machtbildung und -legitimation, sichergestellt.
RDF: Ich sehe das anders. Nur, wenn auf kommunaler Ebene Transformation gelingt, wird sie auch auf Landes-, Bundes- und Europaebene umgesetzt. Insbesondere die Verwaltung kann zur gesellschaftlichen Wende beitragen, wenn sie sich selbst transformiert und öffnet. Das beginnt beim Selbstwirksamkeitsethos der Mitarbeiter und der Ausbildung agiler Teamstrukturen, z.B. als abteilungsübergreifende Reflexionskreise und führt zu einer eingebetteten Bürgerberatung wie z.B. niederschwelligen Hausparlamenten und zufallsbasierten Bürgerräten. Dadurch entsteht in der Verwaltung eine transformative Prozesskompetenz. Im Prinzip wäre solch eine Prozesskompetenz auch für die Optimierung der Zusammenarbeit mit anderen Ressorts und dem Bundestag erforderlich, doch liegt dieses Feld bislang noch in der Parteilogik.
RH: Das hieße, letztlich sollte auch die Parteiendemokratie in einem transformativen Verwaltungsstaat aufgehen?
RDF: Nun, die Transformationsfähigkeit kommunaler Verwaltungen hängt wesentlich auch von der Transformationsbereitschaft der politischen Ebene ab, das ist klar.
RH: Aber noch einmal zur Verdeutlichung: Soll die Verwaltung oder die Politik die zentrale Rolle bei der Gestaltung oder gar Transformation der Gesellschaft spielen?
NL: Die Rationalität der Verwaltung setzt voraus, dass ihre Entscheidungen politisch vorprogrammiert sind. Das geschieht zum Beispiel durch die Einrichtung des Haushaltsplans. Wenn zum Beispiel einer Behörde ein Geldbetrag für den Neubau einer Schule zugewiesen wird, kann und soll (!) sie die Schule mit diesen Mitteln so gut wie nur irgend möglich bauen, ohne daran denken zu müssen, dass eine bescheidenere Schule der Feuerwehr zu einem neuen Auto verhelfen könnte.
RDF: Meine zentrale Erkenntnis war und ist, dass es sich letztlich aus Sicht der öffentlichen Hand um eine personalpolitische Frage handelt: Wie kann Verwaltung ein guter Arbeitgeber sein und bleiben? Damit Verwaltung die Besten anzieht – jene, die Transformation transformativ gestalten wollen.
NL: Bisher war es auch ein Vorteil, dass der Alltag für den Beamten geregelt ist. Er kann seine Gefühle daher für sich behalten. Aber ja, vom Handelnden her gesehen, macht Routine in der Verwaltung sein Verhalten ausdrucksschwach. Er handelt unpersönlich, spiegelt lediglich Informationen in Entscheidungen hinüber, ohne selbst sichtbar zu werden. Diese Blockierung von Selbstdarstellungschancen führt dazu, dass der Mensch in solchen Situationen sein Handeln nicht mehr benutzen kann, um von sich selbst zu zeugen und sich im sozialen Echo selbst zu hören. Wir fassen das mit dem Begriff der Entfremdung. Es wäre jedoch nicht undenkbar, dass Verwaltungssysteme einen Menschentyp erfordern, der nicht darauf angewiesen ist, sich selbst laufend in elementaren Kontakten darzustellen. Er muss seine expressiven Bedürfnisse vertagen lernen. Wir haben noch keine Ethik für solche Lösungen und neigen dazu, sie als menschlich unbefriedigend zu verwerfen. Aber es könnte sein, dass uns da ein altes Vorurteil narrt.
RH: Ein Schlusswort von Ihnen beiden?
RDF: Ich träume davon, dass wir als föderale Demokratie so transformationsfit werden, dass uns warm ums Herz wird, wenn wir nachts an Deutschland denken, seelenruhig wieder einschlafen und uns auf den nächsten gemeinsamen Tag in einem friedlichen Europa und einer nachhaltigen Welt freuen können.
NL: Aufgaben werden sinnlos, Geld entwertet, Werkzeuge nutzen ab. Ämter bleiben.
Zum Nachlesen bei Luhmann: „Schiften zur Organisation 1. Die Wirklichkeit der Organisation“, Springer VS, 2018
Es handelt sich bei diesem Interview um eine fiktive Zusammenstellung von Zitaten aus den genannten Quellen.
Umwelt an Gehirn – Gehirn an Umwelt
Januar 2024
Unsere Wahrnehmungen sind eine „kontrollierte Halluzination“ unseres Gehirns, was wir als Wirklichkeit begreifen, ist also nichts „Objektives“, sondern quasi abhängig von der Bauart unseres Denkorgans. Der Neurowissenschaftler Anil Seth popularisiert diese Erkenntnis derzeit auf allen Kanälen. Eine Konsequenz dieser sich inzwischen weit verbreitenden Auffassung betrifft auch die Umwelt- und Klimadebatte. Glaubte man lange Zeit, durch ein Mehr an sachlicher Aufklärung und wissenschaftlicher Information die Bereitschaft von Menschen zu fördern, das Klimaproblem anzuerkennen und sich dementsprechend vernünftig und zukunftsbewusst zu verhalten, rückt jetzt das Gehirn mit seiner eigenen Funktionsweise in den Fokus. Kimberly Doell und ihre Kollegen und Kolleginnen vom Institut für Psychologie der Kognition an der Universität Wien fragen deshalb in ihrem Beitrag „Leveraging neuroscience for climate change research“ (in Nature Climate Change | Volume 13 | December 2023 | 1288–1297): „Welche neurowissenschaftlich fundierten Erkenntnisse können uns helfen, den Klimaschutz zu fördern? Konkret: Wie lassen sich neuronale Prozesse gezielt nutzen, um die Akzeptanz massiver klimapolitischer Maßnahmen zu steigern?“
Es geht um Antworten auf die Frage: Wie funktioniert „Gehirn an Umwelt“ – also die aktive Verarbeitung und „Halluzination“ des Klimaproblems im Gehirn?
Die Wiener Neurowissenschaftler stellen dazu u.a. fest, dass ihre Disziplin ja bereits fundierte Einblicke in die relevanten neuronalen Vorgänge liefere. Sie berichten: „Beispielsweise zeigten Teilnehmer in einer kürzlich durchgeführten Studie, als sie aufgefordert wurden, darüber nachzudenken, wie sie ihr umweltfreundliches Verhalten verbessern könnten (zum Beispiel beim Fahren mit dem Zug), eine erhöhte Aktivität in Gehirnregionen, die an der Belohnungsintegration beteiligt sind. Umgekehrt zeigten die Teilnehmer, wenn sie angewiesen wurden, über die Verringerung umweltschädlicher Verhaltensweisen nachzudenken (z. B. die Reduzierung der Heizung), eine erhöhte Aktivität in Regionen, die an der Vorhersage von Verlusten und der kognitiven Kontrolle beteiligt sind.“ Bemerkenswert fanden die Forscher daran, dass die Menschen „eine Verstärkung umweltfreundlicher Verhaltensweisen für praktikabler halten als eine Verringerung ihres umweltschädlichen Verhaltens“.
Diese Dissoziation auf neuronaler Ebene könne uns helfen, „besser zu verstehen, warum Menschen in der Lage sind, neue umweltfreundliche Verhaltensweisen anzunehmen und gleichzeitig weiterhin umweltschädliche Gewohnheiten beizubehalten“. In diesem „inkonsequenten“ Verhalten liegt also weder ein charakterlicher Mangel noch ein kognitives Defizit, sondern es ist eine Konsequenz unserer neurobiologischen Ausstattung.
Auch der Neurowissenschaftler Henning Beck hat sich mit diesem scheinbaren Widerspruch auseinandergesetzt. Er kommt zu dem Schluss: "Das Gehirn kann zwar eine Vorstellung von der Zukunft aufbauen. Aber wir sind in dieser Zukunft eine fremde Person." Und die Interessen dieser fremden Person seien eigentlich irrelevant gegenüber unseren heutigen Bedürfnissen. Aus der Zukunftsperspektive betrachtet mag der Verzicht auf bestimmte Verhaltensweisen zur Befriedigung unserer heutigen Bedürfnisse zwar angemessen erscheinen, aber für das Belohnungssystem unseres Gehirns spielt das keine Rolle. Unser Gehirn belohnt uns nicht für Verzicht.
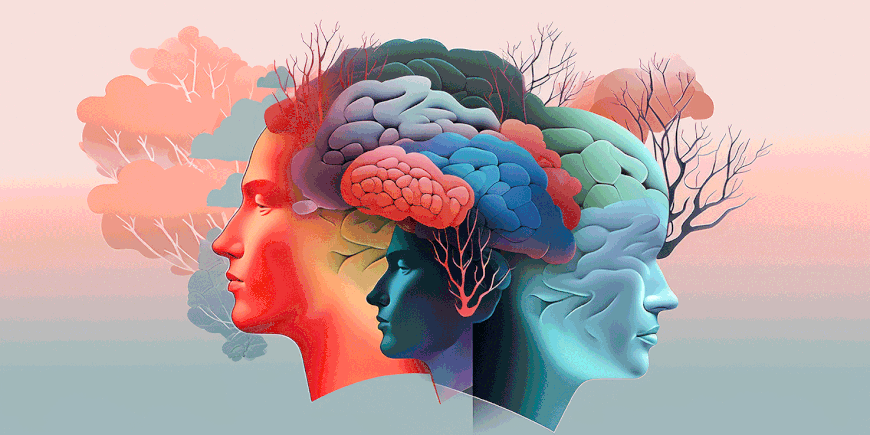
Kimberly Doell und ihre Kolleg(inn)en geben in einer Tabelle einen Überblick über die verschiedenen kognitiven und emotionalen Verarbeitungsprozesse des Gehirns, die mit Aspekten der Verarbeitung des Klimaproblems befasst sind. Sie benennen sogar die entsprechenden neuronalen „Orte“, an die diese Prozesse hirnphysiologisch gebunden erscheinen. Wir haben die Tabelle noch etwas aufbereitet, um die Zusammenhänge zu verdeutlichen:
„Gehirn an Umwelt“: Aktive Verarbeitung des Klimaproblems im Gehirn
Bewusstsein für zukünftige Folgen des Klimawandels
Abwägung der aktuellen Kosten des Klimaschutzes gegen die zukünftigen Folgen der Untätigkeit
Bewusstsein für die Risiken von Klimaschutzhandeln im Vergleich zu Nichthandeln
Bewusstsein für die soziale Natur des Klimaproblems
Einschätzung des Belohnungswerts bestimmter Maßnahmen; Prognose des Bedarfs an nachhaltigen Produkten in der Bevölkerung
Integration von Kosten und Erträgen im Zusammenhang mit eigenen Verhaltensoptionen; Vorhersage des allgemeinen Effekts von Kommunikationsstrategien
Übersetzung von Absichten in konkrete Handlungen
Kognitive und emotionale Prozesse
Kursiv: Eigene Ergänzungen
Mentale Simulationen der Zukunft: Wie verknüpfen wir bestehende Erfahrungsinhalte mit Vorstellungen unseres zukünftigen Lebens?
Zeitliche Diskontierung: Je weiter entfernt die möglichen Folgen zeitlich von uns sind, desto weniger beeinflussen sie unser Verhalten heute
Risikowahrnehmung und Verlustaversion: Abhängigkeit der gegenwärtigen Bereitschaft zum Verzichten/Vermeiden von den „halluzinierten“ Verlusten in der Zukunft
Mentalisierung und Perspektivenübernahme: Welche Annahmen treffe ich über die Verhaltensabsichten und Reaktionsweisen der Menschen meines sozialen Umfelds? Wieviel Berechenbarkeit und Vertrauen entsteht dadurch?
Antizipieren von Belohnung: Mit welchen sozialen Belohnungen für umwelt- und klimafreundliches Verhalten kann ich rechnen?
Verinnerlichung von Werten: Bestätigung von wertegebundenen Verhaltensweisen in meinem sozialen Umfeld
Kognitive Kontrolle: Ausmaß der individuellen Selbstwirksamkeitserwartung (Glauben an die eigene Kompetenz und Handlungseffizienz)
Neuronale „Orte“
Ventromedialer präfrontaler Kortex,
Hippocampus, parahippocampaler Kortex
Dorsolateraler präfrontaler Kortex, posteriorer Parietalkortex
Amygdala, Insula, ventromedialer präfrontaler Kortex, Striatum
Temporoparietaler Übergang, posteriorer cingulärer Kortex, medialer präfrontaler Kortex
Ventrales Striatum, ventromedialer präfrontaler Kortex, Amygdala, medialer orbitofrontaler Kortex
Medialer präfrontaler Kortex, ventrales Striatum, anteriorer cingulärer Kortex, Insula
Dorsolateraler präfrontaler Kortex, anteriorer cingulärer Kortex, Parietallappen
Die Neurowissenschaftler verbinden mit dieser Zusammenstellung die Hoffnung, dass „Hirnstimulationstechniken es Forschern ermöglichen, psychologische Modelle nachhaltiger Entscheidungsfindung kausal zu testen, indem sie die zugrunde liegenden neurokognitiven Prozesse experimentell manipulieren“. Die Hirnforschung könnte auf diese Weise Anleitungen liefern, wie wir unsere Gehirne direkter und gezielter trainieren können, um Verhalten zu verstärken, das Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz besser Rechnung trägt.
Neben dieser Option von „Gehirn an Umwelt“ gibt es, worauf die Autoren von „Leveraging neuroscience for climate change research“ ebenfalls hinweisen, auch die umgekehrte Beziehung „Umwelt an Gehirn“. Im Negativen zählen dazu z.B. die Befunde von Umwelt-Epidemiologen, die nahelegen, dass hohe Feinstaubkonzentrationen das Gehirn schädigen können.
Positiv hingegen sind Zusammenhänge zwischen Naturkontakt/Bewegung im Grünen und der Gehirnleistung: „Bedingungen unserer Umwelt wie der Zugang zu Grünflächen oder andere Aspekte der Stadtentwicklung wirken sich auf Gehirn und Psyche aus. Die Begrenzung der Zeit, die man im Freien verbringt, kann schädliche Auswirkungen auf das Gehirn haben“, stellen Kimberley Doell und das Autorenteam fest. So reduzierte in Untersuchungen ein 60-minütiger Spaziergang in einer grünen Waldumgebung die stressbedingte Aktivität in der Amygdala signifikant im Vergleich zu einem Spaziergang in einer städtischen Umgebung. Außerdem hätten „psychologische Untersuchungen darüber hinaus herausgefunden, dass ein verstärkter Kontakt mit der Natur und Grünflächen mit einem umweltfreundlicheren Verhalten einhergeht.“
Aus Sicht der Neurowissenschaft mag es nachvollziehbar sein, dass die Forscher aus solchen Erkenntnissen das Interesse ableiten, diese positiven Wirkungen des Naturkontakts noch effizienter zu gestalten, indem man die Wirkung auf das Gehirn noch direkter und unmittelbarer erzeugt – nämlich „mit alternativen Strategien, die in Innenräumen umgesetzt werden können, wie z. B. die Exposition gegenüber Pflanzen oder Tieren oder immersive virtuelle Naturszenarien“. Ob wir mit der VR-Brille vor den Augen im Lehnsessel zuhause den virtuellen Naturkontakt tatsächlich der körperlichen Bewegung in realen Naturräumen vorziehen sollten? Es hängt am Gehirn ja doch noch ein ganzer Körper mit seinen motorischen und sensitiven Funktionen und Bedürfnissen. Und auch das Gehirn braucht wahrscheinlich mehr als den virtuellen Kontakt mit der Außenwelt, um seine „halluzinatorischen“ Fähigkeiten zu trainieren.
Aktiv zuhören heißt - unterbrechen
September 2023
Den anderen „ausreden“ zu lassen und ihm zuzuhören, bis er oder sie mal einen Punkt macht, gilt immer noch als wenigstens höfliches Erfordernis der Kommunikation, oft sogar als Beleg dafür, dass man besonders achtsam und respektvoll ist. Jemandem „ins Wort zu fallen“, wird sanktioniert, und wer so etwas öfter macht, gilt als schlechte/r Zuhörer/in. Das Gegenteil ist der Fall!
Immer noch scheint in der Vorstellung vieler Kommunikation nach dem klassischen Sender-Empfänger-Modell zu funktionieren. Der/die eine sendet, der/die andere empfängt das Gesendete. Und der Zweck der Übung, so wird unterstellt, bestehe darin, das Gesendete möglichst 1:1 beim Empfangenden loszuwerden. Und wenn letzterer bestätigt, dass es angekommen ist, dann „versteht“ man sich. Tatsächlich ist dieses Bemühen um das Gehört-Werden noch lange nicht Kommunikation. Die beginnt erst, wenn der Sender sich dafür interessiert, was beim Empfänger überhaupt ankommt – wo es eine Resonanz gibt und wie der Empfänger das Gesendete aus seiner Sicht versteht oder nicht versteht. Das heißt: Kommunikation ist Differenzerfahrung und setzt das Interesse und die Bereitschaft beim Sender voraus, sich damit zu beschäftigen, was beim Empfänger vor sich geht, wenn er mir zuhört.

Oft bemüht sich der Sender, durch Nachdruck, Wiederholungen und eben dieses eingangs erwähnte „Ausreden-wollen“ sicherzustellen, dass der Empfänger das Gesendete genauso interpretiert, wie der Sender das meint. So als ob man sich erst dann versteht, wenn man die Welt aus denselben Augen zu sehen imstande ist wie das Gegenüber. Da das jedoch grundsätzlich nicht möglich ist, wird diese Art des Kommunizierens, das nur auf Selbstbestätigung hinausläuft, kein Mehr an gegenseitigem Austausch und Verstehen erzeugen.
Viele arbeiten hart daran, sicherstellen zu wollen, dass die anderen und die Außenwelt einen selbst und die Welt genauso so sehen, wie man das selbst tut. Dabei wäre es viel interessanter und würde mir mehr über mich selbst und die anderen verraten, wenn ich mich für die Unterschiede interessiere.
Das Pochen darauf, „ausreden“ zu können, verschließt mir dagegen diese Perspektiven. Wenn mich jemand unterbricht und an einem Punkt einhakt, wo es auch für ihn bedeutsam zu sein scheint, erfahre ich doch viel mehr über mich und den anderen, denn genau an dieser Stelle begänne das Verbindende. Kommunikation entsteht aus der Diversität der Kommunizierenden – und damit vergrößern wir die Welt. In unseren Trainings zur Veränderungsmoderation trainieren wir genau dies: Aktiv zuhören heißt unterbrechen.
Think negative!
Juli 2023
Das „gute Leben für alle“ gilt heute im Zeichen der „Agenda 2030“ als das ultimative Ziel all dessen, was durch eine „nachhaltige Entwicklung“ der Welt erreicht werden solle. Bis zum Jahr 2030 wolle man „alles aus dem Plan fertig haben“, heißt es zuversichtlich und in leichter Sprache auf der Website der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V.. Und das Institute for Multi-Level Governance and Development der Wirtschaftsuniversität Wien konkretisiert diese Zielvorstellung des guten Lebens für alle „als Zeitwohlstand, als florierende Nahversorgung, gutes Essen und reduzierten Mobilitätszwang“.
Ist es wirklich das, was die Menschen weltweit motiviert? Der Managementberater Reinhard K. Sprenger ist skeptisch. In einem Beitrag mit dem Titel „Die positive Kraft des negativen Denkens“ schreibt er: „Wenn man mit Menschen spricht, bin ich immer wieder erstaunt, wie unterschiedlich sie ihr Leben gestalten. Der eine sucht Geld, der andere Freizeit, der eine soziale Bedeutung, der andere friedvollen Rückzug. Letztlich weiß niemand, was in einem absoluten Sinne gut, richtig und wahr ist“ („Gehirnwäsche trage ich nicht“, Campus, 2023). Wie kommen wir also dazu, unter dem Ethos-Label „Nachhaltigkeit“ ein einheitliches Lebensglück und -ziel für alle zu postulieren?
Tatsächlich fällt auf, dass in der emotionalen Ausstattung des Menschen die „negativen“ Gefühle die „positiven“ bei weitem dominieren. So beschreibt der Begründer der integrativen kognitiven Verhaltenstherapie, Harlich Stavemann, den Kreis der menschlichen Grundgefühle mit sechs „negativen“ und nur zwei „positiven“ Gefühlen: Trauer, Ärger, Angst, Niedergeschlagenheit, Scham und Abneigung stehen Freude und Zuneigung gegenüber Wir scheinen als Spezies also eher darauf programmiert zu sein, negative und bedrohliche Zustände wahrzunehmen. Warum ist das so? Die Antwort gibt die Psychologin Fanny Jimenez, sie „liegt in der überaus wichtigen Funktion, die Emotionen für den Menschen haben. Positive Gefühle sind zwar schöner, negative aber sichern das Überleben. Denn sie liefern eine blitzschnelle Einschätzung der Lage und bereiten die Reaktion auf sie vor: ob man von Freunden oder Feinden umgeben ist, ungerecht oder gerecht behandelt wird, oder ob etwas gefährlich ist oder nicht.“
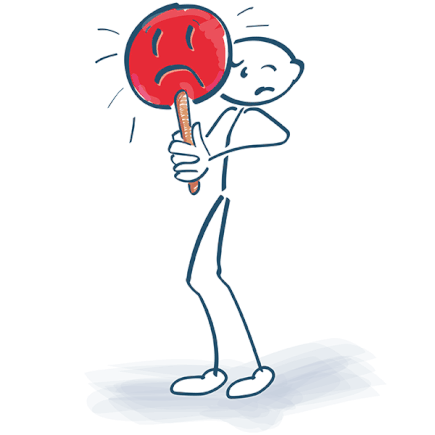
Und weil das so ist, scheint es uns auch viel leichter zu fallen, uns darüber zu verständigen, was wir nicht wollen. Reinhard Sprenger plädiert aus diesem Grund für das negative Denken: „Was ist das, was du nicht willst? Darüber sind sich die meisten Menschen schnell einig… Und es sind nur wenige Dinge: körperliche Gewalt etwa, Krankheit, Krieg. Die negative Reziprozität ist als bescheiden, sie will Schlimmes abwenden. Es biegt jedenfalls nicht ab ins allgemein Wünschbare.“ Sprenger hält die Perspektive auf das Negative, das zu Vermeidende deshalb am besten geeignet, „als ein moralischer Universalkonsens anerkannt zu werden“, denn darauf könne „sich selbst eine heterogene Gesellschaft einigen“.
Wäre es also nicht sehr viel produktiver, wir würden uns anstelle der ständigen Neuauflagen von „Purpose“ gesättigter, alle beglückender Menschheitsziele und Nachhaltigkeitspostulate auf eine „negative Ethik“ verständigen, die kein Ziel hat außer dem, konkret absehbaren Schaden zu vermeiden? Und ansonsten die Menschen machen lassen, wie sie wollen? Eine solche Ethik möchte, wie Sprenger feststellt, „keinen Endzustand erreichen, kein Paradies auf Erden.“ Pandemie, Ukraine-Krieg, Energieprobleme und die geopolitischen Umbrüche dürften uns inzwischen ja auch zusätzlich geholfen haben, aus naiven Träumereien aufzuwachen.
Spannend ist, dass „Think negative!“ inzwischen auch in der Managementpraxis, in der Teamführung und in der Moderation von Entscheidungsprozessen angekommen ist. Die Orientierung auf Widerstände (was die Menschen nicht wollen) anstatt auf Zielverheißungen, die im „systemischen Konsensieren“ erfolgreich praktiziert wird, etabliert sich zunehmend und führt zu besserer Team-Perfomance.

Dieser Beitrag ist auch als Kommentar im forum Nachhaltig Wirtschaften erschienen.

Wolfgang Haber hat unseren Blogbeitrag kommentiert:
"Ich gebe Ihnen völlig recht, dass "Think negative" der viel besser geeignete Ansatz zur Erreichung von Nachhaltigkeit im Rahmen der menschlichen Denk- und Handlungs- sowie Gefühlsvielfalt ist. Der im Naturschutz eingebürgerte Begriff der "biologischen Vielfalt" ist ja nicht nur die Vielfalt der Arten und Ökosysteme, sondern ein Kennzeichen jeglichen Lebens, genauso wie Stoffwechsel und Fortpflanzung. Leben ist Vielfalt, und das gilt nicht nur für die nichtmenschlichen Lebewesen, sondern genauso für die Menschen mit ihrer Vielfalt von Interessen, Meinungen, Standpunkten, Handlungsweisen, Lebensgestaltungen, oft mit stetem Wechsel verbunden. Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen für eine erfolgreiche weitere rationale Arbeit!"
Wolfgang Haber ist der Doyen der deutschen wissenschaftlichen Ökologie. Als Wissenschaftler und Berater hat er über lange Jahre hinweg die deutsche Umwelt und Naturschutzpolitik wesentlich geprägt. Er half unter anderem mit, die ersten deutschen Nationalparks zu etablieren und war 1993 erster Träger des Deutschen Umweltpreises der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.
Gesundheit ist nicht der Krieg gegen die Krankheit. Wie die Corona-Pandemie zu einem besseren Verständnis in der Medizin beitragen kann
Juni 2022
Nach zwei Jahren Pandemiegeschehen ist die Zeit reif für eine wissenschafts- und medizintheoretische Reflektion. Jetzt müsste es möglich sein, kritisch auf die grundlegenden Denkmuster und Paradigma zu einzugehen, die die Pandemiepolitik bestimmt haben, ohne gleich zwischen die Fronten von Querdenkern und Virologen zu geraten. Tristan Nolting hat in seiner Masterarbeit „COVID-19 aus biopsychosozialer Perspektive“ diesen Versuch gewagt. Seine „Analyse der Pandemie in Deutschland“ ist soeben im Tectum Verlag erschienen und dadurch einer größeren Öffentlichkeit zugänglich*.
Nolting nutzt die Analyse der Corona-Episode, um Argumente für die Erweiterung der naturwissenschaftlich biomedizinischen Sichtweise in Richtung auf ein „biopsychosoziales Krankheitsmodell“ (BPSK) zu finden. Vereinfacht kann man sagen, dass das in der Pandemiebekämpfung bisher dominierende biomedizinische Modell das SARS-CoV-2-Virus als gefährlichen Aggressor begreift, den es zu bekämpfen und besiegen, am besten auszurotten gilt. Mangels medikamentöser Optionen dabei nicht-pharmakologische Interventionen (NPI) wie Lockdown, Masken- und Testpflicht, Quarantäneanordnungen etc. im Vordergrund, später kamen Impfungen hinzu. Der Mensch wurde dabei reduziert auf seine Funktion als Krankheitsüberträger, der im Grunde selbst hilflos sich nur durch Anpassung an die „Corona-Regeln“ richtig verhalten und schützen konnte.
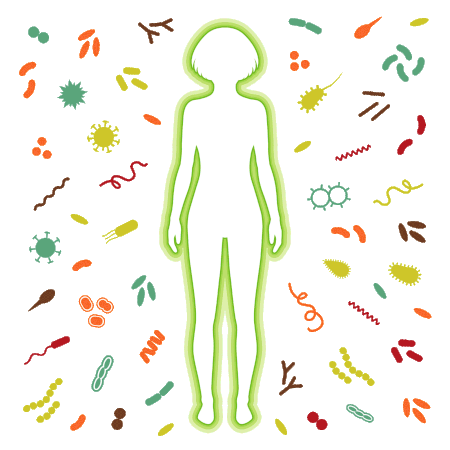
Aus Sicht des ganzheitlicheren biopsychosozialen Konzepts sind es zwei wesentliche Aspekte, die bei dieser Form der Virenbekämpfung aus dem Blick geraten und dadurch selbst gesundheitlich kontraproduktive Wirkungen erzeugen:
- Der eine Aspekt betrifft das Verhältnis zwischen Gesundheit und Krankheit bzw. Mensch und Virus. Vorherrschend ist häufig immer noch ein dichotomisches Modell, wonach Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit ist. Dass es sich jedoch mehr um ein Kontinuum zwischen zwei Polen handelt, macht z.B. die Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) deutlich: „Gesundheit ist ein positiver funktioneller Gesamtzustand im Sinne eines dynamischen biopsychologischen Gleichgewichtszustandes, der erhalten bzw. immer wieder hergestellt werden muss.“ Wer Gesundheit so definiert, erkennt an, dass Viren oder Bakterien nicht einfach nur „unsichtbare Feinde“ sind, sondern dass „die Entwicklung des menschlichen Immunsystems evolutionär auf Viren und Mikroorganismen angewiesen ist“. Wir haben es also mit einem ständigen wechselseitigen Anpassungsprozess zu tun, der unser Immunsystem fordert und fördert. Aus dieser Perspektive stünde nicht der Kampf gegen ein Virus im Vordergrund der Gesundheitspolitik, sondern die Stärkung unseres Immunsystems und gesundheitsfördernder Verhaltensweisen.
- Die Reduzierung der Pandemiepolitik auf die rein virologische Perspektive ignoriert die psychischen und sozialen Bedingungen von Gesundheit und nimmt ein möglicherweise sehr hohes Maß an gesundheitlichen Kollateralschäden in Kauf. Nolting referiert: „Diverse Forschergruppen kommen inzwischen auch zu dem Schluss, dass NPI wie Lockdowns und Kontaktbeschränkungen in Deutschland vermehrt zu Gewalt, Angst, Distress, depressiven Symptomen, verringerter Autonomie, verminderter Beziehungsqualität und allgemein schlechterer mentaler Gesundheit, insbesondere auch bei Kindern und Jugendlichen beigetragen haben.“ Chronische Angst führt zu psychosomatischen Problemen und schwächt das Immunsystem. Letztlich kann uns jedoch nur unser Immunsystem gegen Viren, also auch das Coronavirus, schützen.
Der biopsychosoziale Blick auf die Pandemie könnte uns eine ganzheitlichere Einschätzung der Risiken ermöglichen und aus dem Panikmodus herausführen. Denn einerseits würden wir dann die NPI sorgfältiger abwägen und auf ihre gesundheitlichen Nebenwirkungen hin überprüfen. Und zum anderen würden wir sehr viel stärker auf das Verantwortungsbewusstsein, die Eigenaktivität und Kooperation der Menschen setzen anstatt auf medial inszenierte Schockwirkungen und existenzielle Urängste. Unser täglich praktizierter Lebensstil (Bewegung, Ernährung etc.) entscheidet in einem wesentlich höheren Maß darüber, wie gesund und widerstandsfähig wir sind, als das Befolgen von Maskenpflichten und Abstandsregeln.
* Tristan Nölting, COVID-19 aus biopsychosozialer Perspektive. Eine Analyse der Pandemie in Deutschland, Tectum Verlag, 2022, 84 S., EUR 26,00
